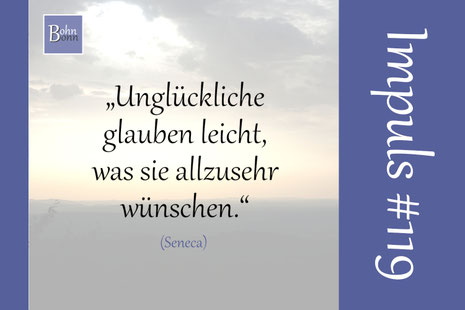
„Unglückliche glauben leicht, was sie allzusehr wünschen.“ – Senecas Weisheit ist über 2000 Jahre alt und dennoch erstaunlich aktuell, wenn man an die heutige Affirmationskultur denkt.
Affirmationen sind überall: in Social-Media-Posts, Ratgeberbüchern und Coaching-Programmen.
„Ich bin erfolgreich.“ – „Ich bin perfekt.“ – „Ich kann alles schaffen!“
Die Botschaft klingt verlockend einfach: Rede dir Positives ein – und du wirst es erleben. Doch wer das ausprobiert, macht manchmal eine überraschende Erfahrung:
Statt Motivation entsteht ein diffuses Unbehagen, statt Selbstvertrauen ein leises Gefühl von Selbstbetrug.
Was ist da los? Funktionieren Affirmationen nun – oder nicht?
Die Antwort, wie so oft in der Psychologie: Es kommt darauf an.
Wann Affirmationen nicht funktionieren – und warum
Die Forschung zeigt ein differenziertes Bild. In einer vielzitierten Studie untersuchte Joanne Wood (2009), wie Affirmationen auf Menschen mit unterschiedlichem Selbstwert wirken. Das Ergebnis: Gerade Personen mit niedrigem Selbstwert fühlten sich nach positiven Selbstaussagen schlechter als vorher.
Warum? Weil eine zu große Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir glauben, kognitive Dissonanz erzeugt. Wenn du dir sagst: „Ich bin brillant in Statistik“, während du genau weißt, dass du noch große Lücken hast, spürt dein Gehirn: Das stimmt nicht. Und dieser Widerspruch kann dein Selbstwertgefühl untergraben, statt es zu stärken.
Zwei typische Beispiele aus dem Lernkontext
👤 Beispiel 1: Die Prüfung. Lisa hat in zwei Wochen eine wichtige Klausur. Sie liest überall von positivem Denken und sagt sich: „Ich schaffe diese Prüfung mit Bravour!“ Jeden Morgen wiederholt sie diesen Satz – aber sie lernt kaum. Die Affirmation ersetzt die Handlung. Sie wird zu einer Art magischem Denken, das die unangenehme Realität überdeckt. Je näher der Termin rückt, desto größer wird die Panik.
👤 Beispiel 2: Die Mathe-Blockade. Tom sitzt vor seinen Analysis-Aufgaben und sagt sich: „Ich bin gut in Mathe. Ich verstehe das.“ Doch mit jeder Aufgabe, die er nicht lösen kann, wächst der Widerspruch. Die Affirmation suggeriert, dass er es können sollte – also darf er keine Fehler machen. Und genau das blockiert ihn. Aus Angst, sich selbst zu widerlegen, traut er sich nicht mehr, frei zu denken.
Drei typische Fallen klassischer Affirmationen
- Sie erzeugen Widerspruch, wenn sie nicht zum eigenen Erleben passen.
- Sie ersetzen Handlung, statt sie zu begleiten.
- Sie suggerieren fixe Zustände („Ich bin perfekt“), die Entwicklung verhindern.
Wann Affirmationen helfen können
Affirmationen sind nicht grundsätzlich nutzlos – sie funktionieren, wenn sie realistisch, erfahrungsnah und prozessorientiert sind.
- Wenn sie an reale Erfahrungen anknüpfen: „Ich habe schon schwierige Phasen gemeistert.“
- Wenn sie Handlung betonen: „Ich arbeite Schritt für Schritt an meinem Ziel.“
- Wenn sie offen bleiben: „Ich lerne aus Fehlern.“
Ihre Wirkung hängt stark vom Selbstwert ab: Wer sich grundsätzlich sicher fühlt, kann sich damit motivieren. Wer zweifelt, erlebt sie oft als Widerspruch – und das erzeugt Druck.
Selbstmitgefühl – die nachhaltigere Alternative
Die Psychologin Kristin Neff hat gezeigt, dass Selbstmitgefühl (Self-Compassion) langfristig wirksamer ist als Selbstkritik – und stabiler als Affirmationen. Selbstmitgefühl bedeutet:
- sich selbst freundlich zu begegnen, auch wenn etwas nicht klappt,
- anzuerkennen, dass Schwierigkeiten zum Menschsein gehören,
- achtsam wahrzunehmen, was ist, ohne es zu verdrängen.
Statt sich einzureden, perfekt zu sein, erlaubt Selbstmitgefühl dir, unperfekt und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Das reduziert Scham und Selbstkritik – zwei der größten Lernblockaden.
Statt: „Ich darf keine Fehler machen.“
→ „Ich bin nervös – und das ist okay. Ich tue, was ich kann.“
Diese Haltung ist ehrlich, freundlich und aktivierend. Sie verleugnet nicht die Realität, sondern integriert sie – und genau das macht sie so kraftvoll.
„Auch-wenn“-Sätze: Widersprüche integrieren statt verleugnen
Eine besonders alltagstaugliche Form dieser Haltung sind die „Auch-wenn“-Sätze, die Dr. Michael Bohne in seiner prozess- und embodimentfokussierten Psychologie (PEP) nutzt.
Bei der Ähnlichkeit unserer Namen muss ich manchmal schmunzeln – ich bin tatsächlich schon mit ihm verwechselt worden. Aber das „-e“ am Ende ist ein wichtiger Unterschied ;-)
Was macht „Auch-wenn“-Sätze so besonders?
Sie sagen: „Ja, es gibt etwas Schwieriges – und gleichzeitig bin ich okay / kann ich handeln / darf ich weitergehen.“ Sie integrieren Widersprüche, statt sie zu leugnen. Dadurch sinkt der innere Druck – und die Energie wird frei für Handlung.
Drei hilfreiche Beispiele
-
Statt: „Ich habe keine Prüfungsangst.“
→ „Auch wenn ich Angst habe, kann ich trotzdem lernen.“ -
Statt: „Ich bin perfekt vorbereitet.“
→ „Auch wenn ich noch nicht alles kann, tue ich mein Bestes.“ -
Statt: „Ich darf keine Fehler machen.“
→ „Auch wenn ich Fehler mache, lerne ich stetig dazu.“
Diese Sätze sind realistisch, wertschätzend und prozessorientiert. Sie nehmen den Druck, sofort anders sein zu müssen – und eröffnen Handlungsspielraum.
Drei Fragen, wenn du mit Affirmationen arbeitest
-
Glaubst du, was du dir sagst?
Wenn nicht, wird es nicht helfen – vielleicht sogar schaden. -
Ist es eine Beschreibung oder ein Wunsch?
Prozesse („Ich arbeite daran“) wirken stärker als Zustände („Ich bin perfekt“). -
Unterstützt es dein Handeln – oder ersetzt es das Handeln?
Affirmationen sollen begleiten, nicht vertrösten.
Fazit: Realismus schlägt Schönreden
Affirmationen sind kein Wundermittel. Sie können helfen – aber nur, wenn sie ehrlich bleiben, an Erfahrungen anknüpfen und Handlung unterstützen. Selbstmitgefühl ist die nachhaltigere Haltung. Es erlaubt dir, unperfekt zu sein, Schwierigkeiten anzuerkennen und trotzdem aktiv zu bleiben. „Auch-wenn“-Sätze sind eine einfache Möglichkeit, diese Haltung zu üben – beim Lernen und im Alltag.
Statt dir einzureden, was du nicht glaubst, erkenne an, was ist – und begleite dich freundlich dabei!
Eine Kleine Übung
Nimm dir fünf Minuten Zeit und überlege:
- Was macht dir gerade Schwierigkeiten beim Lernen oder im Alltag?
- Was sagst du dir normalerweise in solchen Momenten?
- Wie könntest du daraus einen „Auch-wenn“-Satz formulieren?
Struktur:
„Auch wenn [Problem], [selbstmitfühlende oder handlungsorientierte Ergänzung].“
Schreib zwei, drei Sätze auf, die sich für dich stimmig anfühlen – und probiere sie in den nächsten Tagen aus. Nicht als Mantra, sondern als freundliche innere Haltung. Beobachte: Was verändert sich?




